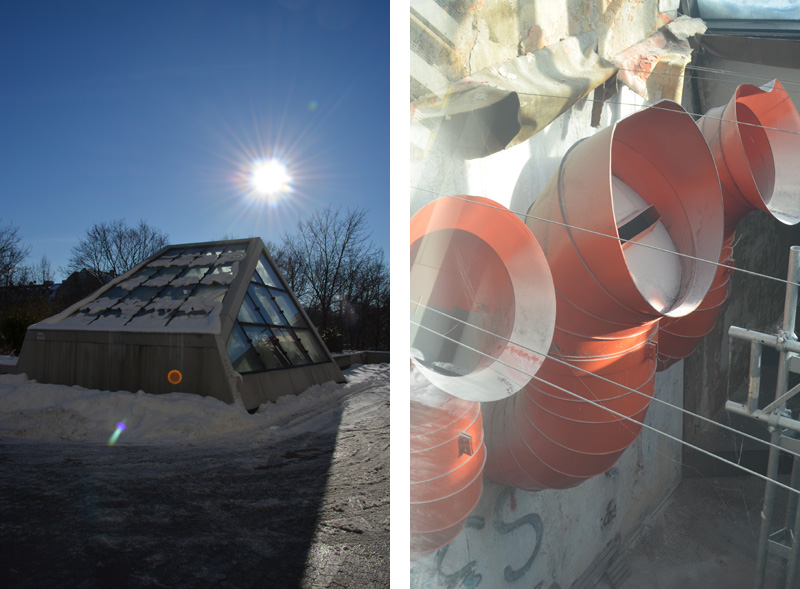Seitenblick Berlin So spannend die Beschäftigung mit der gebauten Nachkriegsmodernde in München
auch ist, kommt man in andere Großstädte, werden die Maßstäbe schnell
zurechtgerückt. Ein gutes Beispiel dafür ist Berlin. Alleine die Fahrt über die
innenstädtische S-Bahn-Trasse eröffnet Blicke u.a. auf den Alexanderplatz mit futuristischem
Fernsehturm, das weite Neubauareal der Bundesbauten, die modernen Schmuckstücke
des Hansaviertels und die Wirtschaftswunder-Architektur am Bahnhof Zoo/Ku'damm.
Interessant finde ich in diesem Zusammenhang allerdings
auch, dass dem reichen Arsenal an modernen Bauten eine relativ bescheidene
Literaturlage gegenüberstand. In den einschlägigen Architekturführern ist die
Nachkriegsmoderne nur sehr knapp vertreten und attraktive Monographien zu den
einzelnen Baudenkmälern gibt es so gut wie nicht, bzw. allenfalls antiquarisch.
Umso lobenswerter ist die Initiative des Reimer Verlags,
unter dem Titel „Baukunst
der Nachkriegsmoderne“ einen dezidierten Architekturführer zu den Bauten
der Jahre 1949 bis 1979 zu veröffentlichen. Auf 500 Seiten enthält das von mehr
als 30 Autoren und Autorinnen der Arbeitsgemeinschaft denkmal!moderne
gemeinschaftlich verfasste Buch mehr als 200 Einträge, die sowohl die
Entwicklung im Westen wie auch im früheren Ostberlin beleuchten. Die Bandbreite
reicht von öffentlichen Bauten über Geschäfts- und Wohnhäuser bis hin zu
Kirchen, Siedlungen und Grünanlagen. Die Menge an Entdeckungen und Anregungen
zu künftigen Streifzügen ist dabei nahezu unbeschränkt.
Gleichzeitig hat das Architekturführer-Format allerdings
auch seine Schwächen: Gerade bei herausragenden Bauten, wie etwa Egon Eiermanns
Gedächtniskirche, Hans Scharouns Philharmonie oder Le Corbusiers Berliner Unité
d'habitation können die knappen Einträge und kleinformatigen (aber immerhin
durchwegs sehr gelungenen) Fotografien das Interesse des Lesers keineswegs
zufriedenstellen. „Baukunst der Nachkriegsmoderne“ eignet sich hier allenfalls
als Appetitanreger für eine vertiefte Lektüre, wozu die in dem Buch enthaltenen
Literaturangaben einen guten Ansatz liefern. Ebenfalls diskussionswürdig ist
die zeitliche Festlegung des Buchs auf die Periode bis 1979, welche dazu führt,
dass eine Reihe interessanter Bauten der Postmoderne leider außen vor bleiben.
Unter dem Strich ist „Baukunst der Nachkriegsmoderne“
dennoch ein gut gelungener, inhaltlich erschöpfender und in einer hohen Qualität
verfasster Wegweiser zu Baudenkmälern, die auch in Berlin oftmals noch gar
nicht als solche wahrgenommen werden. Und aus der Perspektive von münchen
modern liefert der Titel interessante Impulse für das angedachte Begleitbuch
zum Blog.